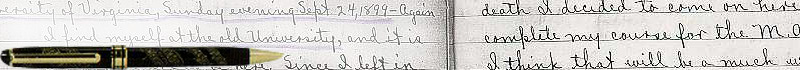Ich simuliere, also bin ich
Man hört vermehrt, dass die Netzgeneration sich geschickter und schneller den neuen digitalen Umwelten anpasst. Diesen Mediendarwinismus halte ich für flach. Abgesehen von der Frage, ob denn wirklich alle so leicht zwischen virtueller und realer Welt hin und her switchen, rechnet das Argument des fliessenden Übergangs nicht mit der Adhäsivkraft der neuen Technologien. Die Gadgets, die unseren Alltag infiltrieren, «kleben» an uns, sinken ein in unsere Psyche. Man halte sich nur das allgegenwärtige Simsen, Twittern, Facebooken vor Augen. In solchem Verhalten äussert sich die Grundbefindlichkeit im Netz: Konnektivität. Ihre Kehrseite: Angst vor dem Nichtverbundensein – vor der Nichtexistenz. Aus dem kategorischen Imperativ des «Be connected!» lässt sich die grassierende Inkontinenz der elektronischen Kommunikation erklären.
«Fakebook»
Wir leben buchstäblich symbiotisch mit den Maschinen. Und in dieser Symbiose riskieren wir, den Kürzeren zu ziehen, d. h. die Balance zu verlieren. Wir sind keine Netzbenutzer mehr, wir sind Netzbenutzte. Vor über fünfzig Jahren, angesichts des massenhaften Aufkommens von Radio und Fernsehen, sprach Günther Anders vom «prometheischen Gefälle» zwischen Mensch und Technik. Der Mensch ist dem, was er hervorbringt, nicht mehr gewachsen. Er wird zum Anhängsel seiner Er findungen. Wenn Leute über ihr verlorenes Handy wie über einen abhandengekommenen Körperteil oder gar einen «Todesfall» klagen, drückt sich darin genau diese meist unbewusste Symbiose aus. – Simulation gehört zum Personsein. «Person» leitet sich ab von «Maske». In den Florentiner Uffizien hängt eine Bildtafel von 1510 mit der Aufschrift: «Jedem seine Maske (sua cuique persona)» – ein perfektes Motto für Facebook, dieses Forum zum Ausprobieren von Masken. Eigentlich müsste es «Maskbook» heissen – oder besser noch: «Fakebook». Das ist nicht per se schlecht. Ein spielerisches Umgehen mit sich und seiner Rolle – ein Sich-Erfinden, um sich zu finden – ist für Heranwachsende äusserst wichtig.
Aber als ebenso entscheidend erweist sich die soziale Viskosität, die Reibung am andern. Jemandem die Meinung ins Gesicht sagen ist viel schwieriger, als eine SMS zu schicken. Virtuelle Freundschaften pflegt man leicht, man kann sie anklicken und wieder wegklicken. Reale Freundschaft dagegen ist eine der härtesten Sachen der Welt. Man muss umgehen lernen mit Intimität und Distanz, mit Kompromiss und Selbstbehauptung, mit Sich-Öffnen und Sich-Abschliessen. Das Schnelle, Kurze und Glatte des virtuellen Miteinanders täuscht darüber hinweg, dass wir gerade in den zwischenmenschlichen Beziehungen die Werkzeuge zur Verfügung haben, unsere sozialen Kompetenzen zu «härten» und zu schleifen. Technologie, die sich anschickt, Heranwachsende von sozialer Reife zu «entlasten», macht das soziale Leben unverbindlich und unwirklich. Eine Gemeinschaft, die lediglich auf Partizipation ohne physische und persönliche Präsenz baut, befindet sich auf dem Weg zur Phantom-Gesellschaft.
Kompletter Bericht: Ich simuliere, also bin ich – NZZ