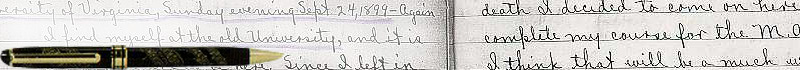Die Kinder der Krise
Das Studium wird immer verschulter, statt dem Lieblings- wird das Vernunftfach gewählt. Darin spiegelt sich auch die Angst, in der Globalisierung zu verlieren.

[…]
Wer heute in die Unis blickt, wird rasch feststellen, dass sich die Studenten so gut wie keine Freiheiten mehr gewähren. Seit Beginn des sogenannten Bologna-Prozesses, der 1999 beschlossen und im Jahr 2010 beendet wurde, betrachtet die junge Generation ihre Lehrjahre als eine Art berufsqualifizierende Maßnahme, so konsequent wie keine zuvor. Mit Bologna ist der europäische Bildungsraum vereinheitlicht worden, damit Abschlüsse nun grenzübergreifend gelten können. Im Zuge dessen wurde das zweistufige Bachelor-/Master-System eingeführt, auch, um die Unizeiten massiv zu verkürzen. Ein Studium soll nun nicht mehr als jene Phase gelten, in der Interessen jenseits des fachlichen Kanons vertieft oder neue Lebensentwürfe erprobt werden. Stattdessen ist der bruchlose Übergang zwischen Schule, Uni und Job das angestrebte Ideal. Was aber hat diese Entwicklung, die man ohne zu untertreiben als europäische Bildungsrevolution bezeichnen kann, mit den Studierenden selbst gemacht? Wie sind die jungen Akademiker von heute eigentlich?
Lern was Vernünftiges!
Seit den frühen achtziger Jahren blickt der Hochschulforscher Tino Bargel in die Seele der deutschen Studenten, er erforscht ihre Werte und Wünsche und erhebt repräsentative Umfragen wie den Studierendensurvey, an dem regelmäßig Zehntausende teilnehmen. „Studenten erwarten von ihrem Studium heute in erster Line die Befähigung zu einem Beruf zu erlangen“, sagt er. Diese sogenannte employability, die maßgeschneiderte Ertüchtigung für den Arbeitsmarkt, sei wichtiger als alles andere und ein sehr neues Phänomen. Normalerweise scheut Bargel Etikettierungen, aber nun wählt er Begriffe, die die heute Immatrikulierten sehr fade erscheinen lassen: „Ohne spezifisches Profil, ohne Kanten, ohne besondere Farbe“ seien sie. Eine „unauffällige Generation“.
Früher waren Unis autarke Laboratorien für Experimente, Parallelgesellschaften im Guten, wo sich junge Menschen ihre persönlichen Erleuchtungen erlaubten. Geschadet hat die Zügellosigkeit den wenigsten, im Gegenteil, etliche Persönlichkeiten haben diese Freiräume genutzt. Im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, in der Bundesrepublik. Da ist Rosa Luxemburg, die eine notorische Fachwechslerin war und sich nach den Naturwissenschaften auch der Ökonomie, dem Recht und der Philosophie zuwandte. Theodor W. Adorno, der sich neben der Lehre an der Philosophischen Fakultät auch dem Dandytum im Kaffeehaus widmete. Oder Helmut Kohl: Er hat sich für sein Geschichtsstudium mit anschließender Promotion heute undenkbare acht Jahre Zeit genommen. Und nicht zu vergessen: In den sechziger und siebziger Jahren waren Hörsäle und Seminare Keimzellen für politische Strömungen, die die Bundesrepublik der Nachkriegszeit umwälzten.
Nicht wenige Studenten von heute klinken sich aus dieser Kontinuität aus. Fragt man Soziologen nach einem Psychogramm dieser Generation, hört man Attribute, die Karriere-Ratgebern entnommen sein könnten: pragmatisch, utilitaristisch, opportunistisch. Auch Klaus Hurrelmann, Leiter der Shell-Jugendstudie, zählt solche Eigenschaften auf, wirbt aber zugleich um Verständnis für das Nutzen-Kalkül-Denken: „Sie richten sich damit nur auf die Chancenstrukturen in unserer Gesellschaft ein.“ Mit anderen Worten: Die jungen Menschen erhoffen sich einen sicheren Arbeitsplatz. Der sei ihnen „sehr wichtig“, gaben 65 Prozent der Studenten an Universitäten im aktuellen Studierendensurvey an – 1993 lag dieser Wert noch bei 50 Prozent. Also belegen sie am liebsten Fächer, zu denen der gönnerhafte Onkel rät, wenn er zur Abi-Feier eingeladen den Neffen beiseite nimmt: „Lern was Vernünftiges!“
Das Fach BWL ist der gemeinsame Nenner dieser Generation – eine Schicksalsgemeinschaft der Besitzstandswahrer und Bildungsaufsteiger, Überflieger und Underdogs, Rastlosen und Ratlosen. Wer einen BWL-Abschluss in der Tasche hat, darf sich auf der sicheren Seite wähnen, denn so massenkompatibel mit den Jobprofilen in Großkonzernen, mittelständischen Betrieben oder im öffentlichen Dienst ist kein anderer Studiengang. Im Wintersemester 2010/11 waren hier laut Statistischem Bundesamt 184.846 eingeschrieben, so viele wie in keinem anderen Fach und knapp ein Drittel mehr als noch vor 20 Jahren. Bei Jura, Medizin und Germanistik dagegen stagnieren die Zahlen
Neben BWL stehen aber auch noch andere Fächer hoch im Kurs, die in den Berufsinformationszentren feilgeboten werden wie Tannenbäume in der Adventszeit: Maschinenbau und Verfahrenstechnik etwa wurden 2010 zusammengerechnet von 171.869 studiert, Informatik wies 133.750 Immatrikulierte auf. Nun sind dies alles grundsätzlich keine ehrlosen Studiengänge, problematisch jedoch ist, dass die Studenten an Pioniertaten immer weniger Interesse zeigen. Nur noch 62 Prozent geben in Bargels Survey an, es sei ihnen „sehr wichtig“, eigene Ideen zu verwirklichen. 1993 lag der Wert noch bei 73 Prozent.
Zu dieser Mentalität, einer Mischung aus Sicherheitsdenken und Willfährigkeit, passen auch die Beschwerden dieser Generation. Sie stöhnen, ächzen und brechen zusammen wie sonst nur Büroangestellte, deren Nine-to-Five-Routine und Gehorsam durch Gehaltsabrechnungen erkauft wurde und bislang das Gegenmodell zum Campusleben war. Nun finden sich die Studenten im selben Hamsterrad wieder. Bei einer Umfrage der TU Chemnitz unter Psychologen von Studentenwerken kam heraus, dass 61 Prozent der Beratungsstellen vor allem in den vergangenen fünf Jahren „einen deutlichen Anstieg von Burn-out im engeren Sinne“ registriert haben. In die Gefühlswelten vieler deutscher Hochschüler hat sich eine Verstörung eingeschlichen, die das Studium zu einer Last macht.
Überall Rationalisierung
Natürlich hat die Einführung der Bachelor-/Master-Studiengänge etwas mit diesen Stresssymptomen zu tun. Universitäten haben sich vielerorts in Lernfabriken verwandelt, in denen Studenten Referate und Hausarbeiten ausbrüten wie Legehennen, getrieben von den Credit Points. Das Studium ist schneller, verschulter, leistungsorientierter geworden. Diese Rationalisierung folgt der Marschroute, die die europäischen Bildungsminister ausriefen, als sie den Bologna-Prozess einleiteten. In einer Deklaration formulierten sie als Ziel, „die arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen der europäischen Bürger (…) zu fördern“. Aus Sorge, die Volkswirtschaften könnten im global verschärften Wettstreit um das beste Humankapital den Anschluss verlieren, wurde Abschied genommen vom traditionellen Studentenbild und seiner altehrwürdigen Rahmung, dem Humboldt’schen Bildungsideal. Zweckmäßig sollte sie nun sein, die Lehre an Hochschulen, organisiert in straffen Stundenplänen, ausgerichtet nach den Bedürfnissen der Personalabteilungen in den Unternehmen. Wenn junge Menschen ihre Vita nun also nüchtern durchplanen wie ein Consultant eine PR-Strategie, aufgepeppt mit Praktika und Auslandssemestern, machen sie nichts anderes, als dieser ökonomischen Logik zu gehorchen. Kollektiv frönen sie der employability.
Die Bachelor-/Master-Reform erklärt aber nicht allein, warum viele Studierende sich so bereitwillig in ihre Rolle als Objekte fremder Begehrlichkeiten fügen. Geprägt haben sie auch die Gefühlsaggregate, die sich in die brüchigen Wohlstandsidyllen ihrer Elternhäuser einnisteten, als sie noch mit erstem Liebeskummer und der neuen Sido-Platte beschäftigt waren. In den frühen und mittleren Nullerjahren, in ihrer Teenager-Phase, sickerten Gifte in bürgerliche Familien, die man zumindest in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte bislang nicht gekannt hatte: Ohnmacht angesichts weltwirtschaftlicher Triebkräfte, Angst vor dem sozialen Abstieg.
Da war die Pisa-Studie, die deutschen Schülern das Wissensniveau Ungarns und der Slowakei bescheinigte und an der Tauglichkeit des Nachwuchses zweifeln ließ. Die Arbeitslosigkeit, die wie ein Menetekel über den noch nicht abbezahlten Reihenhäusern schwebte – und von der rot-grünen Regierung mit der Hartz-IV-Reform bekämpft wurde, einer beispiellosen Aufkündigung sozialstaatlicher Gewissheiten. Überhaupt der ganze Sabine-Christiansen-Alarmismus dieser Ära, der von der Mittelschicht mehr Leistung, Härte, Egoismus forderte, damit Deutschland in der Globalisierung den Anschluss nicht verpasse. Der Bologna-Prozess spielte sich vor dem Firmament dieser Untergangsstimmung ab.
„Studenten sind Kinder ihrer Zeit“, sagt der Hochschulforscher Tino Bargel, „und die ökonomische Begleitmusik ihrer Sozialisation hat Irritationen ausgelöst.“ Die größte Furcht wurde ihr jedoch eingeimpft, als 2008 mit den Pleiten großer Banken die Erosion des Finanzsystems begann.
Doch die Verfehlungen einer Managerkaste, deren Verhaltenslehren noch Teil ihrer Erziehung waren, hat statt Protest nur Passivität ausgelöst. Sie fühlen sich machtlos gegenüber den Urgewalten einer wankenden Welt. Umso wichtiger ist ihnen die Kontrolle über die eigene Biografie. Vielleicht ist das auch der Grund, warum eine Bewegung wie Occupy hierzulande nicht mehr als ein pfadfindergroßes Zeltlager war. Überhaupt sagen nur 37 Prozent der Befragten im Studierendensurvey, allgemeines politisches Interesse zu hegen. 1983 waren es noch 54 Prozent.
Kaum arbeitslose Akademiker
Dabei ist die Angst, die ihre Hände im Spiel hat bei der nervösen Bastelei an einer bombensicheren Zukunft, eine Schimäre. Ob man sein Studium in neun oder zwölf Semestern geschafft hat, ist den meisten Arbeitgebern egal. Und die Gefahr, nach einem Studium ins Prekariat abzustürzen, tendiert gegen Null, selbst in geisteswissenschaftlichen Fächern. Die Akademikerarbeitslosigkeit beträgt in Deutschland gerade einmal 2,5 Prozent. Es gibt keine Anzeichen, dass sich daran etwas ändern wird. Existenzängste müssen allein die gleichaltrigen, meist männlichen Grenzgänger aus den Randgebieten der deutschen Komfortzone verspüren, diejenigen, die in Berlin-Marzahn, in der Dortmunder Nordstadt oder in mecklenburgischen Dörfern um ihren Hauptschulabschluss kämpfen mussten. Doch deren raue Lebenswirklichkeit zwischen Niedriglohnjob und Arbeitslosengeld wird vor lauter Selbstbespiegelung gerne vergessen. Kein Wunder, an den Unis bleiben die Sprösslinge aus der Mittelschicht meist unter sich. Nur zwei Prozent der Studierenden kommen aus Arbeiterhaushalten.
Es ist eine tragische Ironie, dass mittlerweile selbst Personalverantwortliche großer Unternehmen, jene Gatekeeper, die Einlass in die Führungsetagen gewähren, von jungen Bewerbern abgeschreckt sind. Ein ehemaliger Personalvorstand der Citibank forderte jüngst: „Die Fähigkeit zur Selbstreflexion muss an den Hochschulen zum Thema gemacht werden.“ Dabei waren es gerade solche Arbeitgeber, denen es die Studenten recht machen wollten. Die Schelte ist auch eine Kritik an der Bachelor-/Master-Umstellung, die den studentischen Profilverlust begünstigt hat. Sie kommt ausgerechnet von denen, die diesen Bruch forciert haben. Vor allem ist sie ein Eingeständnis: Es geht um den Unsinn einer akademischen Bildung, deren Primat der Arbeitsmarkt ist. Und darum, dass diese Ökonomisierung letztlich sogar der Wirtschaft schadet.
Aus dem Klammergriff können sich nur die Studenten selbst befreien – indem sie ihr Studium nicht zur bloßen Stufe auf der Karriereleiter degradieren. Trotz des Tunnelblicks, zu dem die Bachelor-/Master-Studiengänge verleiten, lassen sich immer noch genug Anreize für Anarchie finden. Man kann zum Beispiel vom Vernunft- zum Lieblingsfach wechseln. Oder ein Semester aussetzen, um zu kellnern. Oder sich an Gleise ketten. Es könnte sein, dass das mehr zur Persönlichkeit beiträgt als die hastige Zufuhr von neuen Credit Points.